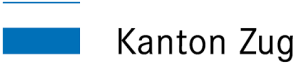Familienforschung
Interessieren Sie sich für die Geschichte Ihrer Familie? Je nachdem, wie weit Ihre Forschungen zurückreichen sollen, kann Ihnen der Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst oder das Staatsarchiv weiterhelfen.

Das Zivilstandswesen des Kantons Zug in der heutigen Form besteht seit 1876. Für die Familienforschung sind die staatlichen Zivilstandsregister von zentraler Bedeutung. Sie enthalten rechtssichere Informationen zu personenbezogenen Daten wie Geburts-, Heirats- und Sterbedaten sowie Angaben zu Eltern, Ehepartnern und Kindern.
Für rechtsverbindliche Auskünfte aus Registern, die jünger als die in der geltenden Zivilstandsverordnung festgelegten Zeitgrenzen sind, ist das Zivilstandsamt zuständig. Das heisst für Auskünfte aus dem Geburtsregister ab 1900, aus dem Eheregister ab 1930 und aus dem Todesregister ab 1960 wenden Sie sich an das zuständige Zivilstandsamt. Ebenso für Auskünfte aus dem seit 1929 geführten Familienregister.
In den folgenden vier Abschnitten erhalten Sie – je nach Art der Personendaten – Informationen über die Auskunft aus Zivilstandsregistern.
Im untersten Abschnitt zeigt Ihnen das Staatsarchiv eine Übersicht über seine Quellen, die insbesondere für die weiter zurückliegende Familienforschung relevant sind. Das sind beispielsweise Pfarrbücher und Bürgerregister. Daneben bewahrt das Staatsarchiv auch die – allerdings nicht rechtsverbindlichen – Doppel der Zivilstandsregister auf.
Auskunft über eigene Personendaten
Jede Person kann beim Zivilstandsamt des Ereignis- oder Heimatortes Auskunft über die Daten verlangen, die über sie geführt werden.
Das zuständige Zivilstandsamt lässt sich hier ermitteln.
Auskunft über Personendaten Dritter
Privatpersonen, die ein unmittelbares und schutzwürdiges Interesse nachweisen können, erhalten die Personenstandsdaten, wenn die Beschaffung bei den direkt betroffenen Personen nicht möglich oder offensichtlich nicht zumutbar ist.
Für die Ausfertigung von Zivilstandsurkunden auf Bestellung sind die Zivilstandsämter zuständig:
- Urkunden über Zivilstandsereignisse (z.B. Geburt, Tod und Eheschliessung) werden vom Zivilstandsamt ausgestellt, das den Vorgang beurkundet hat.
- Ausweise über den Personenstand und den Familienstand werden vom Zivilstandsamt des Heimatortes oder, wenn die Person das Schweizer Bürgerrecht nicht besitzt, durch das Zivilstandsamt des Wohnsitzes oder Aufenthaltes oder des letzten Wohnsitzes ausgestellt.
- Familienausweise und Partnerschaftsausweise können ausserdem vom Zivilstandsamt ausgestellt, erneuert oder ersetzt werden, welches das letzte Ereignis bezüglich der betroffenen Person beurkundet hat.
- Auszüge aus den in Papierform geführten Zivilstandsregistern werden vom Zivilstandsamt erstellt, welches das Register aufbewahrt.
Das zuständige Zivilstandsamt lässt sich hier ermitteln.
Auskunft an Adoptierte oder leibliche Eltern von Adoptierten
Wenn Sie adoptiert worden sind, können Sie sich an die kantonale Auskunftsstelle in Ihrem Wohnkanton wenden.
Auskunft über die Personendaten an Forschende (Ahnenforschung / Genealogie)
Forschende erhalten Personenstandsdaten, wenn deren Beschaffung bei den betroffenen Personen nicht möglich oder offensichtlich nicht zumutbar ist. Für die Datenbekanntgabe ist eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde nötig. Um Personendaten einer Drittperson oder sogar eines nahen Familienangehörigen zu erhalten, muss eine Privatperson nachweisen, dass sie die Daten nicht von der direkt betroffenen Person beziehen kann und dass sie ein unmittelbares und schutzwürdiges Interesse an der Bekanntgabe der Personenstandsdaten hat.
Forschende müssen ein wissenschaftliches Interesse geltend machen und den Schutz der Personendaten der betroffenen Personen garantieren.
- Falls Sie nur in Ihrer geraden Linie (Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern usw.) forschen möchten, können Sie sich direkt an das zugerische Zivilstandsamt des betroffenen Heimatorts wenden.
- Falls Sie auch die Seitenlinien (Onkel, Tanten, Grossonkel, Grosstanten usw.) Ihrer Familie interessieren, benötigen Sie für die Forschung eine Bewilligung zur Bekanntgabe von Personendaten. Benutzen Sie dafür das untenstehende Gesuchsformular.
Erfolgt die Datenbekanntgabe zum Zweck der personenbezogenen Forschung (Ahnenforschung), so dürfen die Ergebnisse nur mit der schriftlichen Zustimmung der betroffenen Personen veröffentlicht werden. Die Forscherin oder der Forscher muss die Zustimmung der betroffenen Personen einholen.
Um eine Forschungsbewilligung zu erhalten, bitten wir Sie, untenstehendes Gesuch auszufüllen und mit allen Beilagen an den Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst zu senden.
Quellen Staatsarchiv
Kirchliche Quellen
Seit Jahrhunderten, bis zur Einführung der eidgenössischen Zivilstandsregister im Jahr 1876, führte die katholische Kirche im Kanton Zug Register zu Taufen, Eheschliessungen und Todesfällen. Die reformierte Kirche führte diese ab den 1860er-Jahren. Diese pfarreiweise aufgezeichneten Tauf-, Ehe- und Sterbebücher stellen die zentrale Quellengruppe für die Familienforschung vom 17. bis ins 19. Jahrhundert dar. Daneben erstellten die Pfarrherren Jahrzeitbücher.
Seit dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts setzte im Kanton Zug in fast allen Pfarreien eine mehr oder weniger konstante Registerführung ein. Die Motive zum Führen dieser Pfarrbücher sind vor allem innerkirchlich begründet. Schon früh aber mischten sich die weltlichen Behörden in die kirchliche Registerführung ein, hatten sie doch auch im weltlichen Recht den Charakter einer öffentlichen Urkunde.
Amtliche Quellen
Mit dem Inkraftsetzen des Personenrechts des Privatrechtlichen Gesetzbuches für den Kanton Zug 1862 wurde erstmals die Einrichtung von amtlichen Geburts-, Ehe- und Totenbüchern geregelt. Das Führen dieser Personenstandsregister blieb aber in den Händen der Pfarreien. Erst seit 1876 führen Zivilstandsbeamte innerhalb der neu geschaffenen Zivilstandskreise nach eidgenössischem Gesetz Geburts-, Ehe- und Sterberegister. Diese Einzelregister wurden doppelt geführt: einerseits die sogenannten A-Register in der Gemeinde des Ereignisses (Geburt, Ehe oder Todesfall), andererseits die B-Register in der Heimatgemeinde. Letztere wurden 1929 durch das Familienregister abgelöst.
Parallel zum eidgenössischen Zivilstandswesen sind von den Bürgergemeinden die sogenannten Bürgerregister geführt worden. Sie entsprechen in etwa dem Familienregister und sind ebenfalls eine wichtige genealogische Quelle.
Ergänzend zu den Pfarrbüchern und Personenstandsunterlagen empfiehlt sich die Benutzung bereits vorhandener Genealogien, so z.B. die Zusammenstellung der Bürgergeschlechter der Stadt Zug von Paul Anton Wickart.
Bürgerregister
Von den Bürgergemeinden gemäss Gemeindegesetz von 1876 geführte Register. Teilweise verfügen die Bürgergemeinden über Register, die deutlich weiter zurückreichen.
Zeitraum
17. Jahrhundert bis heute
Aufbewahrung (Originale)
Bürgergemeinden
Benutzung
- Staatsarchiv Lesesaal: Mikrofilme
- Zum Teil Formular "Einsichtsbeschränkung"
- Innerhalb der 100-jährigen Schutzfrist gesuchspflichtig
Genealogien (u.a. Familienbücher, Stammbäume)
Privat angelegte Zusammenstellungen zur Familienforschung.
Zeitraum
16. – 20. Jh.
Aufbewahrung (Originale)
Diverse Orte
Benutzung
- Staatsarchiv Lesesaal: zum Teil Mikrofilme
- Zum Teil Formular "Einsichtsbeschränkung"
- Innerhalb der 100-jährigen Schutzfrist gesuchspflichtig
Jahrzeitbücher
Von Pfarreien und Klöstern geführte Verzeichnisse der alljährlich an bestimmten Daten für die Seelenruhe von Verstorbenen zu feiernden Gedächtnisse.
Zeitraum
16. – 20. Jh.
Aufbewahrung (Originale)
Pfarreien
Benutzung
- Staatsarchiv Lesesaal: Mikrofilme
- Frei zugänglich
Pfarrbücher (Kirchenbücher)
Von Pfarrern als Ereignisregister (Taufe, Heirat, Beerdigung) handschriftlich geführte Bücher.
Zeitraum
17. Jh. – heute
Aufbewahrung (Originale)
Pfarreien
Benutzung
- Staatsarchiv Lesesaal: Mikrofilme
- Formular "Einsichtsbeschränkung"
- Innerhalb der 100-jährigen Schutzfrist gesuchspflichtig
Doppel der Zivilstandsregister
Gemäss den bundesrätlichen Vorschriften trugen die Zivilstandsbeamten Geburt, Eheschliessung und Todesfall, sofern in der Gemeinde geschehen, in die sog. A-Register ein. In den B-Registern wurden alle auswärtigen Ereignisse der Gemeindebürger festgehalten. Geführt wurden die B-Register vom Zivilstandsamt des jeweiligen Heimatsortes. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurden jeweils Doppel hergestellt. Die Originale werden bei den Zivilstandsämtern aufbewahrt.
Zeitraum
A-Register von 1876 – 1953
B-Register von 1876 – 1910
Aufbewahrung
Staatsarchiv
Benutzung
- Staatsarchiv Lesesaal
- Formular "Einsichtsbeschränkung"
- Gemäss Eidg. Zivilstandsverordnung (ZStV; SR 211.112.2) gelten folgende Zivilstandsregister ab 1876 als Archivgut:
a. Geburtsregister vor dem 1. Januar 1900;
b. Eheregister vor dem 1. Januar 1930;
c. Todesregister vor dem 1. Januar 1960.
Damit unterstehen die Zivilstandsregister dem kantonalen Archivgesetz (BGS 152.4) und sind mit der 100-jährigen Schutzfrist belegt, also innerhalb der Schutzfrist gesuchspflichtig.
Zusätzliche personengeschichtliche Quellen
Bürgerbuch (Edition), Wanderbücher, Reisepässe, Heimatscheine, Volkszählungen
Zeitraum
15. Jh. - 20. Jh.
Aufbewahrung
Staatsarchiv
Benutzung
- Staatsarchiv Lesesaal: zum Teil Mikrofilme
- Innerhalb der 100-jährigen Schutzfrist gesuchspflichtig